| MAX NEUHAUS RUNDFUNK ARBEITEN: PUBLIC SUPPLY Wenn ich an 1966 zurückdenke, kommt es mir vor, als ob ich fast zufällig mit meinen Rundfunkarbeiten begonnen hätte. Die Musikdirektorin des Radiosenders WBAI in New York bat mich damals um ein Interview. Beim Nachdenken über das Interview hatte ich eine Idee - anstatt zu reden, könnte ich doch eine Radioarbeit produzieren! Ich war damals Performer, wollte aber über die Performance und Kompositionsarbeit hinausgehen: Ich wollte eine Art Katalysator für klangerzeugende Aktivitäten werden. Mir wurde klar, daß ich mit dem Telefon eine wichtige Tür zum Senderaum aufstoßen konnte: Wenn ich im Studio Telefonleitungen legte, könnte jeder von jedem Telefon aus diesen Raum akustisch betreten. Damals gab es noch keine Livesendungen, bei denen man anrufen konnte. Meine Idee, die Telefonanrufe direkt zu senden, anstatt sie vorher aufzuzeichnen, wurde nicht gerade mit offenen Armen aufgenommen. Der Techniker war überzeugt, daß der Sender seine Lizenz verlieren würde, und wollte mit der ganzen Sache nichts zu tun haben. Seine Lösung war, ein Mikrophon im Studio aufzustellen und so zu tun, als handle es sich um eine etwas eigenartige Interviewsendung. Ich brachte die Telefongesellschaft dazu, zehn Telefone im Studio zu installieren, indem ich behauptete, wir bräuchten sie für einen Spendenaufruf. Der Techniker lachte und fragte mich, wie ich die Anrufe alle beantworten wollte. Außerdem mußte ich eine Möglichkeit finden, die Anrufe zu senden - für die Vorbereitungen im Studio hatte ich nur eine Stunde Zeit, direkt vor der Sendung. Gemeinsam mit einem Freund baute ich dann einen wunderbaren Vorläufer der Anrufbeantworter für zehn Leitungen. Jedes Telefon stand auf einem kleinen Podest und hatte unter jedem Hörer einen magnetgesteuerten Hebel. Über die Hörkapseln war je ein Plastikbecher gestülpt, in dem sich ein Mikrophon befand. Die Mikrophone und Magnete wurden über einen Schaltkasten gesteuert; Potis regelten die Lautstärke der Mikrophone. Die Ausgabe erfolgte über einen Verstärker und einen Lautsprecher. Ein paar Minuten vor Sendebeginn schaute der Tontechniker herein, in der Erwartung, ein hoffnungsloses Chaos vorzufinden. Was er sah und hörte, war zwar etwas eigenartig, aber nicht chaotisch: zehn Telefone auf dem Fußboden mit auf- und niederhüpfenden Hörern und Stimmen, die aus einem Lautsprecher vor seinem Mikrophon kamen. Dem Techniker blieb nicht viel anderes übrig, als mit uns auf Sendung zu gehen. Mit den Ergebnissen hatte niemand gerechnet. Ich hatte vorher in einer Aussendung die Sendezeit und Telefonnummer bekanntgegeben, also gab es genügend Anrufe. Es gab sogar so viele Anrufe, daß es eine Art Glücksspiel wurde, durchzukommen, denn jeder Anruf mußte exakt mit dem Ende eines anderen Anrufs zusammentreffen. In der Aussendung stand auch, daß jede Art von Klängen gesendet würde und daß die Radios während der Anrufe eingeschaltet bleiben sollten, damit ich mit unterschiedlichen Feedbacks arbeiten konnte. Ich betrachtete mich als eine Art Moderator: Ich versuchte, interessante Kombinationen verschiedener Anrufe zu bilden und eine ausgewogene Mischung herzustellen, indem ich extrovertierte Anrufer mit introvertierten zusammenspannte.
Wir wissen nicht viel über die Geschichte der Klangaktivitäten in früheren Kulturen. Es sind zwar Kunst- und Gebrauchsgegenstände erhalten, aber keinerlei Klänge. Aufnahmetechniken gibt es erst seit sechzig Jahren. In unseren Geschichtsbüchern stehen andere Dinge. Wir besitzen nur Schriftstücke und Zeichnungen, die Jahrtausende alt sind. Deshalb wissen wir auch nicht sehr viel über die Musik der Vergangenheit: wie sie wirklich klang, wer sie spielte, welchen Platz sie in der Gesellschaft einnahm. Über alle diese Fragen läßt sich schon streiten, wenn man nur wenige Jahrzehnte zurückgeht. Bei der Erforschung von Kulturen, die von der modernen Zivilisation unberührt blieben, stießen die Anthropologen immer wieder auf ganze Gemeinschaften, die miteinander Musik machen - nicht auf eine kleine Gruppe, die Musik für Zuhörer macht, sondern auf Musik als einen klanglichen Dialog, der alle Mitglieder einer Gemeinschaft einbezieht. Auch wenn ich diese Gedanken 1966 noch nicht artikulieren konnte, erscheinen mir diese Arbeiten heute, nach vielen Jahren der praktischen Arbeit, der Gespräche und des Nachdenkens, als Aufforderung zur Rückkehr zu einer Musik, die in Vergessenheit geraten ist und die vielleicht der Ursprung allen menschlichen Musizierens ist: nicht die Produktion eines Musikerzeugnisses für Zuhörer, sondern die Schaffung eines Dialogs ohne Sprache, eines Dialogs der Klänge. Mit diesen Arbeiten wollte ich die nötigen Rahmenbedingungen schaffen, damit gewöhnliche Menschen diesen nonverbalen Dialog aufnehmen können. Unser Gehörsinn und unsere stimmliche Ausdrucksfähigkeit sind uns eigen und hoch entwickelt, wie wir beim Umgang mit der Sprache beweisen. Telefon und Radio bieten eine gute Ausgangsbasis für diesen Dialog, weil sie die Konzentration auf Klänge fördern und ihre visuelle Anonymität uns hilft, Hemmungen zu überwinden. Das eigentliche Problem liegt nur darin, Fluchtwege aus den gängigen Vorstellungen von Musik zu finden. Aus "Public Supply I" hatte ich gelernt, daß man mit einem gewöhnlichen Mischpult unmöglich zehn Telefone gleichzeitig steuern kann. Ich mußte also eine Möglichkeit finden, mir meine Fingerfertigkeit als Musiker besser zunutze zu machen. Dazu konstruierte ich ein "Fingermischpult": eine Platte, auf der vier Fotozellen pro Finger der Form meiner Hand entsprechend angeordnet waren. Jedem Anrufer wurden zwei dieser Fotozellen zugewiesen, über die ich seine Lautstärke und Stereoposition aussteuern konnte. Mit einer leichten Handbewegung regulierte ich den Lichteinfall auf die einzelnen Fotozellen und kontrollierte damit Lautstärke und Position aller zehn Anrufer gleichzeitig. Die Feinsteuerung war so gut, daß aus dem Mischen und Gruppieren ein schneller und dynamischer Prozeß wurde. Das Fingermischpult setzte ich erstmals 1968 in Toronto ein. |
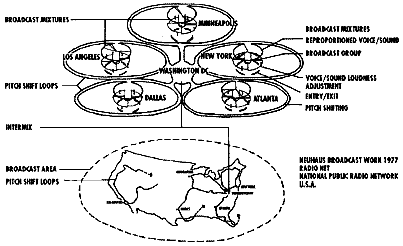 |
1973 dann, bei meiner Arbeit für den Sender WFMT in Chicago, war es mit dem Guerillakrieg vorbei - nach sieben Jahren begann man das Konzept allmählich zu begreifen. Ich beschäftigte mich damals mit speziellen Instrumenten, auf denen die Anrufer mit ihrer Stimme spielen sollten. Für die Arbeit in Chicago konstruierte ich einen speziellen Schaltkreis für die einzelnen Leitungen. Das Prinzip war recht einfach: Oszillatoren, deren Tonhöhe von der akustischen Energie der Anrufe bestimmt wurde. Die Signale wurden über einen so langen Zeitraum integriert, daß eine Bank von zehn Tönen entstand, die sich graduell, je nach Anrufer, in der Tonhöhe veränderten und immer wieder neue Cluster bildeten. Die Geräusche des Anrufers selbst überlagerten sich diesem Tongeflecht. Im gleichen Jahr machte ich National Public Radio den Vorschlag, nicht nur mit einem Sender zu arbeiten, sondern das ganze landesweite Netz aus zweihundert Radiostationen miteinander zu verbinden. Die Hörer sollten in fünf Städten, New York, Dallas, Atlanta, Minneapolis und Los Angeles, beim Sender anrufen. |
[TOP]
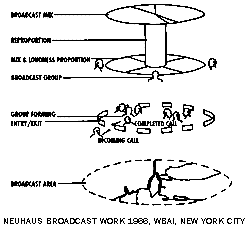 Nach der Sendung war ich, glaube ich, leicht geschockt: Ich hatte keine Idee entwickelt, sondern die Idee war mir fertig präsentiert worden. Langsam begriff ich die Dimensionen des Ganzen. Die Karte unten am Bildschirm zeigt Manhattan Island; rechts davon liegen Brooklyn und Queens und darüber die Bronx. Ich hatte einen virtuellen Raum geschaffen, den jeder einzelne der zehn Millionen Bewohner dieses Gebiets durch Wählen einer Telefonnummer betreten konnte. Das gab mir einigen Stoff zum Nachdenken.
Nach der Sendung war ich, glaube ich, leicht geschockt: Ich hatte keine Idee entwickelt, sondern die Idee war mir fertig präsentiert worden. Langsam begriff ich die Dimensionen des Ganzen. Die Karte unten am Bildschirm zeigt Manhattan Island; rechts davon liegen Brooklyn und Queens und darüber die Bronx. Ich hatte einen virtuellen Raum geschaffen, den jeder einzelne der zehn Millionen Bewohner dieses Gebiets durch Wählen einer Telefonnummer betreten konnte. Das gab mir einigen Stoff zum Nachdenken.