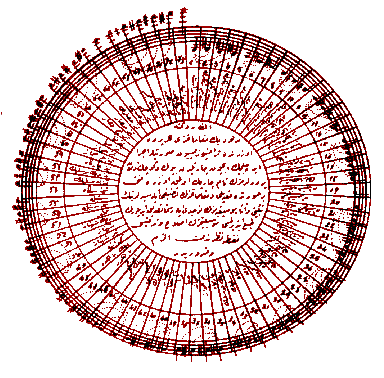|
Interview mit Rupert Huber vom 18. Juli 2007:
Eines ihrer Arbeitsfelder nennen Sie "dimensionale Musik" – woher kommt diese Bezeichnung?
Das ist der Versuch, einen adäquaten Namen zu finden für diese Art von Kompositionen oder Musikstücken, die ich mache, und die sich aus dem heraus und auch von dem weg entwickelt haben.
Was die akustische Ebene bei Medienprojekten betrifft, habe ich das runtergerechnet auf folgende drei Stationen: Input – dass man etwas reinspielt; Transform – dass das Ursprungsmaterial verändert und umgedeutet wird; und Output – also dass es irgendwo zu hören ist, sonst wäre es nicht mehr existent. Diese drei Gegebenheiten müssen bearbeitet werden, damit das Stück entstehen kann. Alle drei sind öffentlich!
Das habe ich dann wiederum umgerechnet auf drei Dimensionen. Eine normale Partitur ist zweidimensional, ein Abdruck wie ein Buch oder die ganzen Rechner-Programme. Ich habe dann theoretisch, wie ich die Sachen setze, in mehreren Schichten, eine dritte Achse in den Raum gesetzt. Das hat zu einem Zyklus geführt – der ist jetzt in Waidhofen gelaufen, oder letzten Herbst in Halle an der Saale.
Das Prinzip hat sich allerdings sehr vereinfacht seit diesen komplexen Gedankenanhäufungen wie "Darb-I Fetih" oder "Berliner Theorie". Ich bin ziemlich froh, dass ich auf diesen relativ einfachen Prozess gekommen bin: dass ich wo hinfahre, Sounds aufnehme und sie im Studio umarbeite. Das wird dann vorzugsweise im öffentlichen Raum als Klanginstallation oder Konzert gespielt. Die räumliche Rückbezüglichkeit ist auch wichtig – und in einem Gespräch über diese Gedanken ist dann einmal die Bezeichnung "dimensionale Musik" aufgetaucht.
Welche Ideen liegen "Darb-I Fetih" zugrunde?
"Darb-I Fetih" ist ein musikalisches Modell dafür, wie sich Musik im heutigen akustischen Gefüge integriert. Ein Ausgangsgedanke war, dass man Musik heute weniger direkt hört, sondern vor allem als Projektion, also über Radio, CDs oder Files. Es ist immer ein Phantom, das da spielt, und das man an- und abdrehen kann. Das gilt es mit der Alltagsbeschallung zu verbinden, also Autogeräusche, das Surren der Klimaanlagen, und all die anderen akustischen Bestandteile, die nicht laut sein mögen aber doch existieren. Dafür wollte ich ein in der Gegenwart verhaftetes Modell entwickeln. Was bedeutet das für den Aufbau des Stückes?
Ich gehe davon aus, dass jeder Stimme – ob Flöte, Beat, menschliche Stimme – eine eigene Zählzeit entspricht. Es ist also nicht eine Überlagerung wie bei Orchesterstücken, sondern eher ein gegenseitiges Kreisen. Veranschaulichen lässt sich dieses Prinzip anhand des Vergleiches mit einem Marktplatz: Leute kommen und gehen, für ein paar Momente stehen sie nebeneinander, und hätte man nur das Standbild vor sich, würden sie als zusammengehörig wahrgenommen werden. Doch dann gehen sie weiter, in verschiedene Richtungen, ohne sich überhaupt zu kennen. Welche Bedeutung hat die menschliche Stimme dabei, ist sie ein Instrument oder Rhythmuswerkzeug?
Sie ist ein Klang, anderen Klängen gleichwertig. Da gibt es zum Beispiel auch Grillen in dem Stück – nicht sehr prominent aber doch. Mich interessiert, wie ein Klang eine Aussage transportiert, die man in Worte übersetzt. Wenn ich jetzt in die Hände klatsche, dann zeigt das Hirn sofort das Wort "Klatschen" an – es wird eingeblendet, wie ein Untertitel in einem Film. Durch die Wortbezogenheit von Klängen bin ich damals darauf gekommen, dass ich die Wortbedeutung von einem Sample assoziativ verwende oder nur so stehen lasse. Später, bei dem Stück "Horror Vacui" waren das ja nur noch Straßenaufnahmen. Es geht also nicht um den Sprachbezug. Das Wort wurde wegen des Klanges ausgesucht, und nicht wegen seiner Bedeutung. Die rhythmische Ebene der Klangzusammenhänge wird dann durch die türkischen patterns bestimmt. Was hat Sie an den türkischen Rhythmusstrukturen interessiert?
Die patterns aus der türkischen Musiktheorie waren eine Inspiration: nach ihnen sind die Stimmen und Sample-Zeiten gesetzt, rhythmisch über die Minute zurückgerechnet.
Obwohl ich dem Phänomen World Music kritisch gegenüber stehe – da nimmst Du eine türkische Flöte und eine senegalesische Sängerin, und dann haust Du einen Beat dazu – das ist nicht so meins. Stattdessen wollte ich bestimmte Elemente verwenden, nicht plakativ, sondern eher wie Stufen, oder als Hilfeleistung für das Stück eigentlich. Wie hat dieses Prinzip von "Darb-I Fetih" dann räumlich funktioniert, in der Artothek in der Schönlaterngasse?
Da habe ich mein Studio aufgebaut für gut zwei Wochen, und die Klanginstallation ist gelaufen. Einige Leute sind gekommen und wollten singen oder Tapes bringen – das war ja damals noch abenteuerlicher als heute, die Publikumsbeteiligung. Das war schön, ja. Bei der Installation selbst ging es mehr um die Bewegung im Kreis, gegen den Uhrzeigersinn. Ein weiterer Ort ist das Internet: das KreispartiturBuch haben Sie vollständig auf die Kunstradio-Site gestellt, womit die einzelnen Elemente öffentlich verfügbar sind.
Im KreispartiturBuch lege ich als Komponist mein Werkzeug offen und schaffe dadurch in gewisser Weise eine open house Situation. Mir ist es darum gegangen zu zeigen, dass nicht der große Meister im Verborgenen über der Komposition brütet und dann mit den Noten daher kommt, sondern ich wollte die Schritte eines Prozesses zeigen. Das ist so, als ob das "making off" schon in dem eigentlichen Film integriert wäre.
Während man als sogenannter Konsument die Internet-Kreispartitur selbst spielen kann, ist die Radioversion von "Darb-I Fetih" allein mein Stück, meine offizielle Version. Und für "Die Sieben Kristallkugeln" haben Sie Kollegen und Bekannte um Klangspenden gebeten – die Bausteine wurden also zugeliefert.
Das war insofern eine schöne Erfahrung, weil die Sounds, die ich bekommen habe, ganz unterschiedlichen Charakters und sehr markant sind. Die habe ich dann nach einem formalen Schema bearbeitet, das sich an einem Band der Comic-Reihe "Tim & Struppi" orientiert. Wie kam es zu der Idee?
Ich habe irgendwann die Idee gehabt, oder vielleicht kann man es sogar Hobby nennen, so nebenbei Sachen, die überhaupt nichts damit zu tun haben, in eine Partitur einzubringen. Also, zum Beispiel der Tisch hier vor uns: ein großes Wasserglas, ein leerer Aschenbecher, ein Schlüsselbund und ein Kaffeehäferl. Durch die Distanz zwischen den Objekten und durch die Figur, die sie ergeben, hätte man schon eine graphische Partitur. Da müsste man jetzt nur festlegen, was welcher Ton ist und welches Instrument.
"Tim & Struppi" hat mir aus Kindheitszeiten gut gefallen, und so hatte ich die Idee aus der Folge "Die Sieben Kristallkugeln" eine Partitur zu schreiben. Ob das jetzt ein Comic ist oder irgendwas anderes war egal – es geht nicht explizit um die Comicgeschichte. Wie haben Sie die graphische Vorlage dann in Klänge umgesetzt?
Ich hatte folgende Parameter: 20 Minuten Dauer des Stücks, 62 Comics-Seiten und eine bestimmte Anzahl an Bildern pro Seite. Das ist ja recht normiert – neun oder elf Bilder sind meistens auf einer Seite. Die Stückdauer durch die Seitenanzahl durch die Anzahl der Bilder ergibt dann, wie lange ein Bild dauert, also in dem Fall etwas über eine Sekunde.
Dann habe ich den Charakteren wie bei einer Orchesterpartitur Stimmen zugeteilt: wenn Tintin da ist, dann gibt es Flöten-Töne, wenn der Hund da ist, gibt es Saxophon-Töne, wenn die böse Mumie Leute verzaubert, dann gibt es Knacksen und so weiter.
Für diejenigen Charaktere, die dauernd im Bild sind, habe ich einfach Dauertöne genommen – wobei ich mir die Freiheit beibehalten habe, Layers oder Melodien einzuweben. Aber dadurch ist schon so ein Grund-Layer entstanden. Lustigerweise ergibt das eine Ambience, in die verschiedene kleine Tracks eingebaut sind, durch die Szenenwechsel und die gleichbleibenden Personen. Es hat sich gut übertragen lassen.
Leider gibt es keine Website, da wir die Bilder nicht verwenden dürfen. Eigentlich war geplant, dass man das Comic dann dazu durchblättern kann. Als Notlösung haben wir gesagt: man kann es sich auch in Heftform anschauen und zum Radiostück im Takt mitlesen, wenn man will. Das geht genauso. Arbeiten Sie noch mit Sam Auinger zusammen?
Jetzt ist gerade ein bissel eine Pause, aber es liegt in der Luft, man braucht es nur runterholen, wenn man will. Ich bin kein Band-Typ, bei mir wird nichts aufgelöst. Man macht etwas, solange der Reiz da ist. Natürlich braucht es Gelegenheiten um etwas aufzuführen, und dazwischen muss man halt warten. Eine ihrer gemeinsamen Kunstradio-Produktionen war "Anna Blume".
Ja, das war aus Spaß an der Freude, wie man sagt. Wir haben aus Stan-und-Ollie-Filmen Geräusche und Klänge genommen, damit herumgespielt und sie gegengesetzt. Das ergibt wildere Layers, und der Schlussteil ist dann wieder synchronisiert. Es ist jetzt kein großartiges Konzept dahinter, außer dass es um diesen Stimm-Klang-Rhythmus geht, und die Infragestellung dessen, was wir glauben was die Klänge sind. Es ist eine Hinterfragung, so würde ich es nennen. Bei Anomalie-Topologie war das Konzept hingegen wichtig?
Da wird es langsam interessant, weil sich das, ähnlich wie bei "Horror Vacui", langsam auflöst. Eigentlich ist es zu dem Ausmaß hörbar und wahrnehmbar, dass ich jetzt ungern vom Konzept erzählen möchte, denn es ist tatsächlich 1:1 hörbar. Wir haben einfach eine Art von Bild im Kopf gehabt, und das kann man wirklich leicht hören und sich dann selber zusammen reimen. Was haben Sie denn so im Rahmen des Projektes "Berliner Theorie" unternommen, während des DAAD-Aufenthaltes in Berlin?
Da muss ich jetzt eine Ecke machen: das Problem war ja immer, dass man gedacht hat, bei kollektiven Arbeiten müsste man eigentlich sein Ego aufgeben. Und Sam Auinger und ich wollten dann eben doch ausloten, wie sehr man Individuum-Künstler bleiben kann, weil wir ja beide nicht unglücklich sind mit unserer künstlerischen Identität.
Im Laufe des Jahres 1997, während eines halben Jahres, haben wir alle zwei Wochen ein sogenanntes Hauskonzert veranstaltet. Zwischen meinem und Sams Studio haben wir Kabeln gespannt. Pro Konzert gab es ein Thema oder einen Gast, und dann haben wir übers Internet gespielt, mit Leuten in Istanbul etwa. Die Konzerte wurde immer irgendwohin übertragen, über Livestream oder Radio, und umgekehrt ist auch von Außen immer ein Komponente hinzu gekommen. Aber vor Ort gab es auch Publikum?
Andauernd, unendlich viele Leute. Das war extrem integrativ. Es gab auch immer Brötchen und so. Die Studios waren etwa 40m2 groß, und die Hauskonzerte waren angekündigt in der Zeitung. Die Leute haben dann oft gefragt: wieso Theorie und was ist die Aussage? Im Sinne der Theorie haben wir nichts rausgefunden – das ganze war eher eine Art Skulptur, eine Echtzeit/Kunst/Skulptur/Event/Performance/KonzertWebsite... etwas in der Richtung.
Das war alles vor 2001, das darf man nicht vergessen. Dadurch war das alles noch relativ sonnenbeschienen, und man hat das Gefühl gehabt, dass man Modelle bauen kann, wie sich das alles besser entwickeln kann, die ganzen Medien, Beziehungen, Cross-Kulturen, das ganze Ding. Diese Art von Bereitschaft sich mitzuteilen, das kann ich mir heute gar nimmer vorstellen, es ist schwer zu beschreiben. Diese Art der Offenheit, die Möglichkeit ein kollektives Soundarchiv zu machen. Und diese Art von Unschuldigkeit mit den ganzen Medien zu spielen. Das war dann nach 9/11 eigentlich schon beendet.
So ein Bruch war 9/11?
Auf jeden Fall. Weil davor hat man gedacht, es hat einen Sinn: man kann nicht nur shoppen im Internet, sondern man kann das tun, was vorher nur großen Radiostationen vorbehalten war. Und es hat auch funktioniert. Jetzt ist es halt ein bissel bieder geworden. Mit myspace, das ist schon sehr kategorisiert oder eingekastelt. Aber immerhin: es ist noch da. Damit meine ich aber weniger meine Perspektive als die der Besucher, die zu uns gekommen sind.
Wir sind bei uns in der Kultur gewohnt, dass die Sachen korrumpiert werden. Wir sind gewohnt, dass etwas existiert und dass es irgendwann aufgekauft wird. Das wird jetzt gerade schlimmer, aber es war schon besser, und dann wird es wieder besser und wieder schlimmer. Das ist unsere neuere Geschichte.
Aber diese Art von Naivität oder Unschuld Medien gegenüber, die eigentlich diese ganzen Zusammenspiele ausgelöst haben, dass jeder mit jedem Musik machen kann – das war ja vorher nicht denkbar. Da hat man ein Studio haben müssen, wertvolle Studiozeit, einen Techniker und einen Messdienst, und das alles war so eine richtige Staatsaffäre. Und auf einmal hockt man da und kann mit irgendeinem billigen Computer mit irgendwem in Istanbul spielen. Das war in gewisser Weise hippiemäßig, eigentlich, wie Woodstock – alles super und geht schon.
Und mit einem Schlag war diese Unschuldigkeit weg – die Medien sind quasi beschmutzt worden durch die Möglichkeit, die andere Leute genutzt haben. So wie Goebbels das Radio verdorben hat, ist jetzt das Internet verdorben. Das muss man schon auch in der Dimension sehen.
Als positiv sehe ich, dass das Internet dermaßen in den Alltagsbetrieb übergegangen ist, dass es als Thema gar nicht mehr vorkommt. Als altem Wort-Auflöser gefällt mir das. Nachdem alles übers Internet läuft – von den Spitälern über die Behörden bis zum Privatleben –, ist es kein Thema mehr. Im praktischen Leben ist es voll angekommen.
Insofern war speziell diese 1997er-"Berliner-Theorie" auch ein Zeitabdruck, retrospektiv gesehen, denn das war ein sehr Internet-betontes Projekt. |